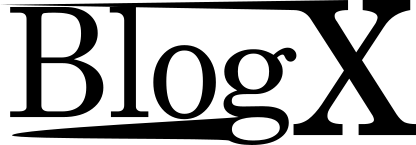Einleitung
Seit einigen Jahren läuft mein Homeserver auf einem QNAP TVS-672X. Das Gerät war in dieser Zeit stets ein zuverlässiger Begleiter – stabil, unkompliziert und für meine Ansprüche lange mehr als ausreichend. Doch mit der Zeit sind die Anforderungen gestiegen: Heute laufen dauerhaft 10 bis 12 virtuelle Maschinen auf dem NAS, und damit stößt das Hardware-Konstrukt zunehmend an seine Grenzen.
Nach so langer Laufzeit ist daher der Punkt gekommen, an dem ein Upgrade sinnvoll ist. Nicht, weil das QNAP schlecht ist – im Gegenteil, es hat seinen Job hervorragend gemacht – sondern weil ich nun mehr Leistung, Flexibilität und Zukunftssicherheit brauche.
Statt erneut zu einer fertigen Lösung zu greifen, habe ich mich diesmal entschieden, einen DIY Homeserver aufzubauen: leistungsstark, erweiterbar und gleichzeitig mit einem klaren Fokus auf stylisches Design und ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis – ich denke, es ist etwas daraus entstanden, das sich aus meiner Sicht wirklich sehen lassen kann.
Mit meinem Projekt DIY Homeserver 2025 möchte ich euch auf meine kleine Reise durch die Qual der Hardwarewahl mitnehmen und zeigen, wie man aus sorgfältig ausgewählten Komponenten einen Homeserver zusammenstellt, der sowohl im Alltag überzeugt als auch genug Reserven für die kommenden Jahre bietet. In den nächsten Beiträgen stelle ich die einzelnen Komponenten im Detail vor – vom Mainboard über die CPU bis hin zum Speicher und Gehäuse.
Hinweis vorab:
Bevor wir starten, möchte ich eines betonen: Die Auswahl der Hardware liegt immer im Auge des Betrachters. Man kann natürlich immer teurer und „besser“ kaufen. Ich habe meine Komponenten für den Homeserver mit Blick auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und anhand der technischen Spezifikationen ausgewählt. Fast alle Teile habe ich während der Cyberweek bei Alternate usw. (Oktober 2025) im Angebot gekauft. Daher verlinke ich in den Beiträgen direkt auf die entsprechenden Produkte bei Alternate, Amazon etc. – nicht als Werbung, sondern einfach, damit ihr die Komponenten nachvollziehen könnt.
Das Herzstück: Mainboard & CPU

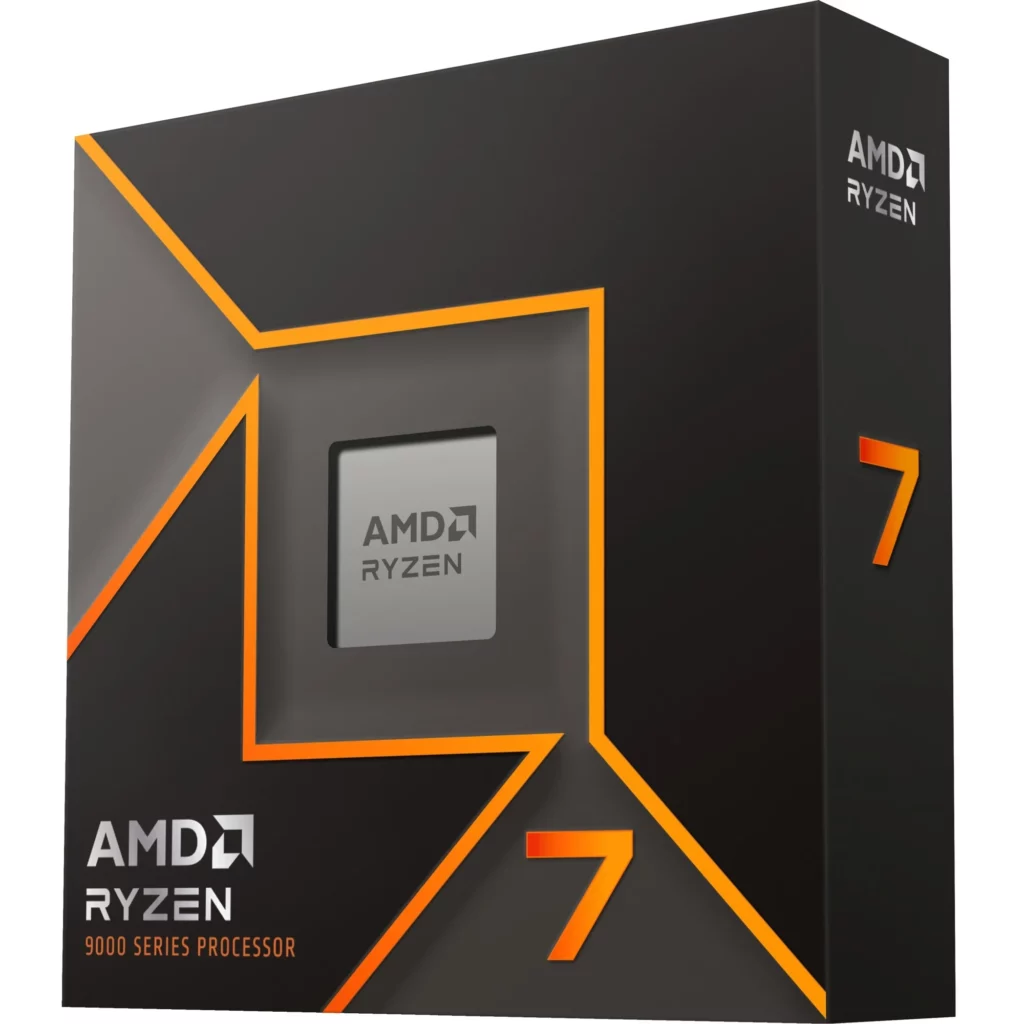
Für meinen Homeserver habe ich mich nach langem Abwägen für eine Plattform auf Basis von AM5 entschieden. Der Grund dafür ist vor allem die Zukunftssicherheit: AMD hat den Sockel bis mindestens 2027 angekündigt, und mit PCIe 5.0 bietet die Plattform genügend Reserven für die kommenden Jahre.
Die Wahl fiel am Ende auf das ASRock B850 Riptide WiFi als Mainboard und den AMD Ryzen 7 9700X als Prozessor.
Das Board bietet eine sehr solide Ausstattung mit 4 M.2-Slots (davon einer mit PCIe 5.0), 4 SATA-Ports für klassische Festplatten sowie ausreichend PCIe-Steckplätzen für Erweiterungskarten. Dazu kommt ein 2,5-Gb-Ethernet-Port für schnelle Netzwerkverbindungen – und das alles zu einem fairen Preis.
Da ich insgesamt mehr als vier Festplatten im Einsatz habe, wird zusätzlich noch eine SATA-Erweiterungskarte eingebaut, um genügend Ports für den geplanten Massenspeicher bereitzustellen.
Der Prozessor bietet mit seinen 8 Kernen und 16 Threads genug Leistung, um dauerhaft 10–20 VMs zu betreiben, ohne gleich in den High-End-Bereich gehen zu müssen.
In einem separaten Beitrag gehe ich detailliert auf die Gründe für genau diese Kombination ein, vergleiche Alternativen und erkläre, warum sie aus meiner Sicht die beste Lösung für mein Projekt war.
Arbeitsspeicher: genug Reserven für viele VMs

Ein entscheidender Faktor für einen Homeserver ist der Arbeitsspeicher, weil in meinem Setup werden dauerhaft viele virtuelle Maschinen parallel laufen.
Ich habe mich für das G.Skill DIMM 64 GB DDR5-6000 (2× 32 GB) Dual-Kit entschieden (EXPO-kompatibel). Damit habe ich:
- ausreichend RAM, um 10–20 VMs stabil zu betreiben,
- eine sehr hohe Geschwindigkeit mit DDR5-6000 – ideal für schnelle Operationen, Caches, Pages etc.,
- und vor allem eine solide Aufrüstbarkeit: Das Riptide Mainboard unterstützt bis zu 256 GB RAM.
Für den Moment ist das Kit mehr als leistungsfähig, und durch die freie Bestückung von zwei Slots kann ich den Homeserver jederzeit erweitern. Im separaten Detailartikel werde ich auf verschiedene Kits eingehen, Alternativen vergleichen und erläutern, warum ich mich letztlich für dieses Set entschieden habe und warum das das wichtiger war als ein paar Prozenzt mehr Leistung.
Speicher: schnelle SSDs & viel Platz auf HDDs

Beim Speicher habe ich zwei Ebenen eingeplant: maximale Geschwindigkeit für das System (Proxmox) und die virtuellen Maschinen und gleichzeitig viel Kapazität für Daten und Medien.
Für das System und die VMs habe ich mich für ein RAID1 aus zwei Team Group T-Force G70 Pro 2 TB NVMe-SSDs entschieden . Damit liegt das Proxmox-Hostsystem sowie die VM-Daten auf sehr schnellen Laufwerken, die durch das Spiegeln zusätzlich abgesichert sind. Hier war für mich wichtig: hohe IOPS, DRAM-Cache und langfristige Stabilität.

Als Massenspeicher für den Homeserver setze ich auf 6 × Seagate IronWolf 8 TB HDDs. Diese Festplatten sind speziell für den Dauerbetrieb in NAS- und Serverumgebungen ausgelegt und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem nutze ich dieselben Modelle bereits für mein QNAP-NAS und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Auf diesem Pool liegen große Datenmengen wie der Nextcloud-Speicher oder Plex-Medien. Je nach Einsatzszenario lassen sich die Platten in einem ZFS-Pool (z. B. RAIDZ2) oder auch als RAID 10 konfigurieren – so erhält man die gewünschte Balance aus Sicherheit und Performance.
Im Detailartikel werde ich genauer auf die Unterschiede eingehen, verschiedene RAID-Level vergleichen und erklären, warum ich mich am Ende für diese Kombination aus schnellen NVMe-SSDs und zuverlässigen Seagate IronWolf HDDs entschieden habe.
Gehäuse & Kühlung: viel Platz und stabiler Betrieb
Gehäuse

Beim Gehäuse fiel die Wahl auf das Thermaltake CTE C750 ARGB Snow für unseren Homeserver. Es handelt sich um einen Big-Tower mit 90°-gedrehtem Mainboard-Layout, das den Luftstrom optimiert. Platzprobleme gibt es hier keine:
- bis zu 7× 3,5″-Laufwerke und 12× 2,5″-Drives lassen sich verbauen,
- selbst große Grafikkarten bis 420 mm Länge oder CPU-Kühler bis 190 mm Höhe passen hinein,
- und für Radiatoren ist das Gehäuse mit fast allen gängigen Formaten bis 420 mm vorbereitet.
CPU Kühler

Damit die CPU auch bei hoher Dauerlast zuverlässig gekühlt wird, setze ich auf die Chieftec ICEBERG 360 RGB Wasserkühlung. Diese AIO-Kühlung nutzt drei 120mm Lüfter und passt perfekt ins C750-Gehäuse. So bleibt der Ryzen 7 9700X auch bei parallelem Betrieb vieler VMs stabil kühl ohne dass die Lautstärke störend wird.
Das Zusammenspiel aus großzügigem Gehäuse und leistungsstarker Wasserkühlung sorgt für Reserven, Stabilität und ein aufgeräumtes Gesamtbild mit genug Platz für zukünftige Erweiterungen.
Netzteil: stabile Basis für den Homeserver

Ein zuverlässiges Netzteil ist einer der wichtigsten Bausteine. Ich habe mich für das Thermaltake Toughpower GT 850W entschieden.
Warum diese Wahl?
- 80 Plus Gold Zertifizierung – hohe Effizienz, weniger Abwärme und Stromkosten
- Vollmodulares Design – nur die Kabel, die wirklich gebraucht werden, für ein aufgeräumtes Setup und gute Belüftung.
- 850 Watt Leistung – genug Reserven auch für Erweiterungen, z. B. eine dedizierte Grafikkarte zum Rendern oder Transcoding
Eine Stabile Spannungsversorgung ist absolut wichtig für einen Dauerbetrieb mit vielen Festplatten, SSDs und VMs. Gerade weil ein Homeserver nicht nur ein paar Stunden, sondern permanent läuft, ist mir hier Zuverlässigkeit vor Preis gegangen. Mit dem Toughpower GT habe ich ein Netzteil, das nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Jahren sicher Reserven bietet.
Erweiterungskarten
Netzwerkkarte: TP-Link TX201 – 2,5 Gbit/s für mehr Durchsatz

Da das Mainboard bereits einen integrierten 2,5-Gbit-LAN-Port bietet, ist die zusätzliche Netzwerkkarte vor allem als zweiter Netzwerkpfad gedacht – für Trennung von Management-, VM- oder Backup-Traffic.
Hier fiel die Wahl auf die TP-Link TX201 2,5G PCIe Netzwerkkarte.
Die Karte basiert auf dem Realtek RTL8125B-Chip, der seit Kernel 5.9 vollständig im Linux-Kernel integriert ist – und damit auch unter Proxmox 9.x ohne zusätzliche Treiber sofort erkannt wird.
Einstecken, neu starten, und die Karte erscheint automatisch als enpXsY-Interface.
Vorteile der TP-Link TX201:
- Volle Linux-Kompatibilität (Proxmox, Debian 12, Ubuntu, etc.)
- Stabile 2,5-Gbit/s-Verbindung mit niedriger CPU-Last
- PCIe x1-Schnittstelle – passt auch bei knappen Lanes ins System
- Kostengünstig, häufig verfügbar und bewährt im 24/7-Betrieb
Damit lassen sich in Proxmox beispielsweise VMs auf eine eigene Bridge legen – etwa getrennte Netzwerke für Verwaltung, Storage (NFS/ZFS-Sync) oder virtuelle Maschinen. Gerade bei Anwendungen wie Plex oder Nextcloud bringt das eine deutlich stabilere Datenverbindung und verringert Latenzen bei gleichzeitigem Zugriff mehrerer Clients.
SATA-Erweiterungskarte: Delock 89042 mit ASM1166-Chipsatz

Um genügend Anschlüsse für alle geplanten Festplatten bereitzustellen, kommt im neuen Homeserver zusätzlich eine SATA-Erweiterungskarte zum Einsatz. Die Wahl fiel auf die Delock 89042, eine PCIe 3.0 x4-Karte mit 6 SATA-III-Ports und dem modernen ASMedia ASM1166-Controller.
Dieser Chipsatz gilt aktuell als einer der zuverlässigsten SATA-Controller für Linux-Systeme.
Er wird vom Kernel ab Version 5.4 nativ unterstützt, wodurch Proxmox (ab Version 8.x) die Karte direkt ohne zusätzliche Treiber erkennt.
Alle wichtigen Funktionen wie NCQ, TRIM, SMART und Hot-Swap werden vollständig unterstützt.
Vorteile der Delock 89042:
- 6 × SATA 6 Gb/s – ideal für HDD-Pools oder RAID-Setups
- PCIe 3.0 x4 mit hoher Bandbreite (~2,2 GB/s netto)
- Stromsparender & stabiler Betrieb durch ASM1166-Chip
- Bootfähig & voll kompatibel mit Proxmox, Debian 12, Ubuntu usw.
- Keine RAID-Zwangslogik – perfekt für ZFS-Pools oder Software-RAIDs
Im laufenden System sollen die 6 Seagate IronWolf 8 TB-HDDs auf zwei Controller verteilt werden:
Drei Laufwerke hängen direkt an den Mainboard-SATA-Ports, die anderen drei an der Delock-Karte.
So wird die Last gleichmäßig verteilt, beide Controller werden effizient genutzt, und selbst im Fall eines Controller-Ausfalls bleibt ein Teil des Pools erreichbar.
Diese Aufteilung sorgt für stabile Performance, geringere thermische Belastung und maximale Ausfallsicherheit im 24/7-Betrieb.
Warum der ASM1166-Chipsatz die bessere Wahl ist
Bei der Auswahl der SATA-Erweiterungskarte standen zwei Chipsätze zur Wahl: der ältere JMicron JMB585 und der moderne ASMedia ASM1166. Beide sind weit verbreitet, werden unter Linux gut unterstützt und sind grundsätzlich zuverlässig – doch im Detail gibt es entscheidende Unterschiede:
Merkmale im Vergleich:
JMB585
- ältere Architektur
- PCIe 3.0 x2 bis x4
- durchschnittliche Energieeffizienz
- Linux-Support ab Kernel 3.3
- gute Leistung, aber unter hoher I/O-Last teils instabiler
- vor allem in Desktop- oder NAS-Systemen verbreitet
ASM1166
- moderne, effiziente Architektur
- PCIe 3.0 x4 nativ
- sehr gute Energieeffizienz, bleibt kühler im Betrieb
- Linux-Support ab Kernel 5.4 (optimiert für aktuelle Systeme)
- sehr stabil bei parallelen Zugriffen und Dauerlast
- ideal für Server, ZFS und 24/7-Betrieb
Der ASM1166 bietet also mehr Reserven, geringere Latenz und höhere Stabilität, insbesondere bei mehreren gleichzeitig aktiven Festplatten – wie es im Homeserver-Alltag mit Nextcloud, Plex oder Backup-VMs häufig der Fall ist.
Gerade in Verbindung mit ZFS oder Software-RAIDs profitiert man von seiner gleichmäßigeren Datenverteilung und besseren Queue-Verwaltung.
Homeserver Einkaufliste / Beschreibung Link
Alle Komponenten wurden für unseren DIY Homserver wie oben schon beschrieben sehr sorgfältig ausgewählt und größtenteils während der Cyberweek bei Alternate und Amazon gekauft. Die Links dienen ausschließlich der Übersicht es ist keine Werbung, sondern meine persönliche Hardware-Auswahl basierend auf Preis, Leistung und Kompatibilität.
- Gehäuse Thermaltake CTE C750 ARGB Snow (Big Tower) – Alternate.de
- Mainboard ASRock B850 Riptide WiFi – Alternate.de
- CPU AMD Ryzen 7 9700X – Alternate.de
- Kühlung Chieftec Iceberg 360 RGB Wasserkühlung Alternate.de
- Arbeitsspeicher (RAM) G.Skill Trident Z NEO RGB 64 GB (2×32 GB) DDR5-6000 – Alternate.de
- System-SSDs (RAID 1) 2× Team Group T-FORCE G70 Pro 2 TB NVMe – Alternate.de
- Massenspeicher (HDDs) 6× Seagate IronWolf 8 TB – Alternate.de
- SATA-Erweiterungskarte Delock 89042 (6-Port SATA, ASM1166) – Jacob.de
(Ich hatte die Karte zuerst bei Let’s Sell bestellt, aber nach fast einer Woche kam weder eine Lieferung noch eine Info, dass der Artikel gerade nicht lieferbar sei. Habe den Artikel dort Storniert am 22.10.2025) - Netzwerkkarte TP-Link TX201 2.5G PCIe – Amazon.de
- Netzteil Thermaltake Toughpower GT 850 W (80+ Gold, modular) – Amazon.de
Fazit & Ausblick
Mit der Auswahl der Komponenten vom Mainboard über CPU, Arbeitsspeicher und Speicherlösungen bis hin zu den Erweiterungskarten steht das Fundament für meinen neuen DIY Homeserver 2025. Alle Bauteile sind bewusst auf Stabilität, Zukunftssicherheit und Effizienz ausgelegt und harmonieren sowohl technisch als auch preislich sehr gut miteinander.
Ziel war es nicht, das absolute Maximum an Performance zu erreichen, sondern ein ausgewogenes System, das
- genügend Reserven für viele virtuelle Maschinen bietet,
- sich flexibel erweitern lässt,
- dabei leise, zuverlässig und energieeffizient bleibt,
- und dabei Preislich auch noch in einem „normalen“ Rahmen bewegt ähnlich eines NAS-Systems
In den nächsten Beiträgen gehe ich detailliert auf die einzelnen Komponenten ein – beginnend mit dem Gehäuse, also der Basis, auf der der gesamte Homeserver aufgebaut wird.
Danach folgen das Mainboard, die CPU und alle weiteren Komponenten im Detail.